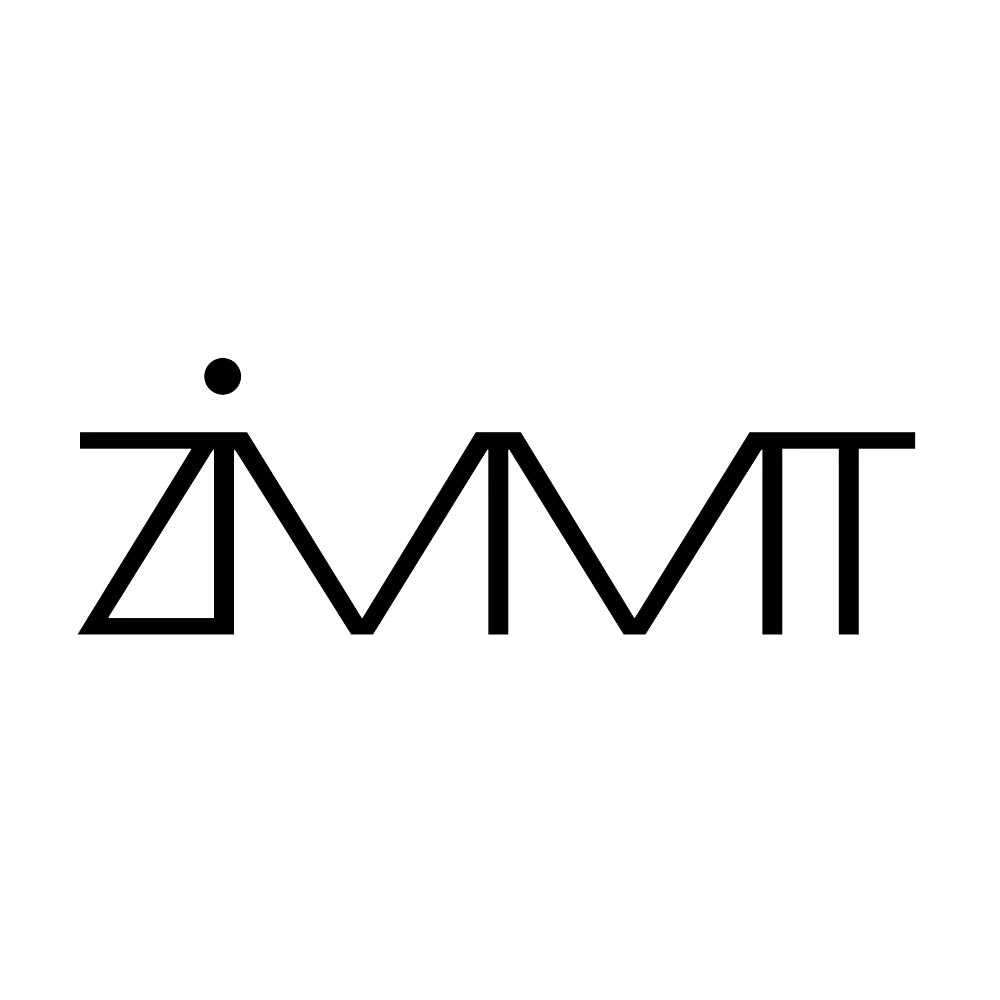Zentrum für immersive Medienkunst, Musik und Technologie
„Der Ursprung aller Dinge, aller Formen, kommt letztendlich aus Bewegung“ – Mary Vieira
In der traditionellen Musik sind Klang und Bewegung unmittelbar verbunden – die Geste formt den Ton. Im digitalen Kontext finden sich Bewegung und Klang plötzlich voneinander losgelöst: Klang kann unabhängig von Bewegung entstehen, Gesten ganz anders klingen, als das Auge ahnt. In den Räumen des ZiMMT im Kontor 80 lotet sens move in 3D Audio Konzerten, Performances, Talks, Workshops und einer Ausstellung neue Beziehungen zwischen Klang und Bewegung aus.
Timetable
DAY 1 (MI 26.11.)
ab 18:00
Panel-Diskussion
Audiovisuelles Konzert: Sabina Covarrubias und
Opening-Performance: Thomas Laigle mit leuchtenden Bakterien
Ausstellung
DJ Set: Oyz
DAY 2 (DO 27.11.)
18:00
Lecture: Stijn Dickel – aifoon Chorus of footsteps
ab 20:00
Tanz- und Sound-Performance: Sara Létourneau & Chantale Boulianne
Konzert: Max Burstyn, Yongbom Lee, Babett Niclas & Agata Patyczek
DAY 3 (FR 28.11.)
13:00–15:00
Workshop mit Robert Wechsler
17:00
kollektiver Hörspaziergang mit Stijn Dickel
18:00
Lecture: Robert Wechsler & Philipp Schmalfuß
ab 20:00
Tanz- und Sound-Performance: Jakob Gruhl, Cheetah Dragon, Tomoko Nakasato & Juliane Zöllner
Audiovisuelles Konzert – Shasha Chen
DAY 4 (SA 29.11.)
14:00–16:00
Workshop: Sara Létourneau & Chantale Boulianne
18:00
Lecture: Alexander Schubert
ab 20:00
Tanz- und Sound-Performance: Clara Sjölin & Paul Hauptmeier
3D Audio Konzert: YAAND & urbau
3D Audio Konzert: Cosmic Bride
DJ Set: La Lvcha
DAY 5 (SO 30.11.)
13:00–14:00 / 14:00–15:00 / 15:00–16:00
Britt Hatzius: Moving out Loud (Immersive sound and haptic experience)
16:00–20:00
Ausstellung
DAY 6–8
16:00–20:00
Ausstellung
Hörflyer
Tickets & Preise
Festival Pass
das Ticket für alle Konzerte, Performances, Vorträge & Ausstellung.
• Full Festival 45€
• Early Bird Ticket: 35€ (bis zum 28. Oktober verfügbar)
Ausstellung
8€ (regulär)
5€ (ermäßigt)
12€ (soli)
Opening (26.11.)
Feierliche Eröffnung mit Panel Diskussion & Konzert
5€
Workshops
18€
(Tickets sind nur online erhältlich.)
Performances
18€ (regulär)
13€ (ermäßigt)
20€ (soli)
- Tickets sind online oder am Einlass erhältlich, Workshop-Tickets ausschließlich online.
- Schwerbehinderte sowie deren Begleitperson erhalten kostenlosen Eintritt.
- Ticketmail: tickets@zimmt.net
Gewinne 1 von 2 Festivalpässen am 24.11. / 19 Uhr bei Radio Blau
move [muv]
„Der Ursprung der Dinge, der Ursprung aller Formen kommt schlussendlich von Bewegung.“ – Mary Vieira
Bewegung ist Energie. Lebendige Körper verwandeln chemische Energie aus Nahrung in Bewegungsenergie, Muskeln ziehen sich zusammen und entspannen antagonistisch, in ihren Fasern ziehen Proteine aneinander. Bewegung ist umpositionieren, anordnen – nicht nur von Gliedmaßen. Auch die Kraft des gemeinsamen gesellschaftlichen Gestaltungswillens wird als soziale Bewegung gefasst, und wenn sich eine festgefahrene Situation aus ihrem Stillstand löst, dann kommt sprichwörtlich endlich Bewegung in die Sache.
Auf altgriechisch heißt Bewegung „Kinetik“, kinetische Kunst entsteht also durch Bewegung – entweder indem ein Objekt sich mechanisch selbst bewegen kann, oder indem es sich durch die Bewegung der Betrachtenden verändert. Ohne Bewegung ist es schwer, die eigene Perspektive zu ändern.
In der Musik war sichtbare Bewegung lange untrennbar mit dem hörbaren Ton verbunden: eine Hand, die schnell und ausholend auf eine Trommel oder eine Klaviatur schlägt, erzeugt einen viel lauteren Ton als eine sanft streichende, kleine Bewegung. Der körperliche Ausdruck, die Geste, passt zur Intensität des Klangs. Im digitalen Kontext finden sich Geste und Klang plötzlich voneinander entkoppelt: synthetische Klangerzeugung wird nicht mehr durch die Kraft der Bewegung bestimmt, ist sogar ganz ohne Berührung möglich. Das Auge kann längst nicht mehr vorhersagen, was das Ohr hört.
In der Loslösung entstehen neue Möglichkeiten, Bewegung in Klang umzusetzen, etwa durch Motion Tracking. Das 3D Audio System des ZiMMT macht es möglich, die Bewegung von Klang im Raum zu hören, ohne die eigene Position zu verändern. Sens move lotet die Facetten der neuen, unabhängigen Beziehung zwischen Klang und Bewegung aus.

Ausstellung
26.11. — 03.12.
Die Bewegung, auch der Besucher:innen, ist ein wichtiger Teil der Ausstellung, welche ganz unterschiedliche Arbeiten an der Schnittstelle von Klang, Form und Bewegung präsentiert. Die Spanne der künstlerischen Positionen reicht von interaktiven Erfahrungen, über kinetische Skulpturen, bis zu phosphoriszierenden Bakterien, deren Bewegung den Klang beeinflusst. Während einige Arbeiten auf räumliche Veränderung reagieren, verändert die Bewegung an anderer Stelle skulpturale Formen und den Klang.
Artists:
- Thomas Laigle
- Marc André Weibezahn
- Luis Kießling
- Nora Frohmann
- Anouk Kruithof
Öffnungszeiten:
Vernissage am 26.11. / 18:00
So (30.11.) – Mi (3.12.) / 16:00 – 20:00
Workshops & Vorträge
Welche neuen Möglichkeiten bietet digitale Technik, Klang durch Bewegung zu beeinflussen? Wie können Sensoren Bewegungen in Töne übersetzen und was bedeutet das für die Beziehung zwischen musikalischem Ausdruck und Geste? In Workshops und Vorträgen geben Künstler:innen detaillierten Einblick in ihre technischen Entwicklungen und ästhetische Forschung zum Thema und ermöglichen uns, die eigene Körperbewegung als Instrument selbst auszuprobieren.
Workshops
- inklusiver Workshop mit Robert Wechsler – 28.11. / 13 – 14 Uhr
- Sara Létourneau & Chantale Boulianne – 29.11. / 14 – 16 Uhr
- Britt Hatzius: Moving out Loud (Immersive sound and haptic experience) – 30.11. / 13:00–14:00 / 14:00–15:00 / 15:00–16:00
Vorträge
- Stijn Dickel aifoon Chorus of footsteps – 27.11. / 18 Uhr
- Robert Wechsler & Philipp Schmalfuß – 28.11. / 18 Uhr
- Alexander Schubert – 29.11. / 18 Uhr
Performances
26. — 29.11.
sens move verbindet 3D Audio-Konzerte und Tanz zu audiovisuellen, immersiven Performances. Sichtbare Bewegung kann Klänge bestimmen, umgekehrt kann Hörbares in bewegtes Bild übersetzt werden. Zwischen choreographischen und skulpturalen Elementen treten akustische und elektronische Instrumente auf, selbstentwickelte Software und Geräte setzen Mensch und Maschine in direkte Verbindung miteinander. Körper und Gesten werden zu kompositorischen Elementen, Bewegung und Musik gehen eine neue Beziehung ein.
Artists:
- Chantale Boulianne & Sara Létourneau
- Cosmic Bright
- Shasha Chen
- Sabina Covarrubias
- Stijn Dickel
- Jakob Gruhl, Cheetah Dragon, Tomoko Nakasato, Juliane Zöllner
- Yaand & urbau
- Max Burstyn, Yongbom Lee, Babett Niclas & Agata Patyczek
- Clara Sjölin & Paul Hauptmeier
Line Up
Chantale Boulianne & Sara Létourneau
Körper, Materie, Klang (Workshop in English 29.11. / 14 – 16 Uhr)
In diesem Workshop laden die Künstlerinnen Chantale Boulianne und Sara Létourneau die Teilnehmer dazu ein, die physischen und sensorischen Beziehungen zwischen Körper, Materie und Klang zu erforschen. Ausgehend von ihrer künstlerischen Praxis leiten sie eine Reihe gemeinsamer Improvisationen und Erkundungen mit Objekten, Materialien und Musikinstrumenten, um neue Wege des Zuhörens, Bewegens und gemeinsamen Spielens zu entdecken. Die Teilnehmenden werden ermutigt, mit Dimensionen und Distanzen zu experimentieren, Dialoge zwischen heterogenen Objekten zu schaffen, an Übergängen zu arbeiten und die Instrumente und Strukturen der Künstlerinnen in ihre eigenen Erkundungen zu integrieren. Jede Erkundungssequenz endet mit kurzen gemeinsamen Präsentationen, die den Austausch und die gemeinsame Reflexion fördern.
Sara Létourneau ist eine multidisziplinäre Künstlerin, die in den Bereichen Bildende Kunst, Musik, Performance, Video und Theater arbeitet. Charakteristisch für ihre Praxis ist ihre Hybridität und die häufige Zusammenarbeit mit anderen Künstler*innen, wodurch Werke entstehen, die die Grenzen zwischen den Disziplinen auflösen. Der performative Aspekt steht im Zentrum ihres Schaffens: Über den bewegten Körper untersucht sie die Resonanzen von Klang, Geste und Material. Ihre Performances verwandeln Räume in immersive Umgebungen, in denen Symbole und Mythologien neue Wahrnehmungsweisen eröffnen. Seit 2006 hat sie mehr als hundert Arbeiten in Museen, Galerien, Theatern, Künstlerhäusern und Festivals in Kanada, den USA, Europa und Asien gezeigt. Neben ihrer Solopraxis ist sie auch in kollektiven Projekten aktiv, die Klang, Szenografie und körperliche Präsenz verbinden.
Chantale Boulianne ist eine multidisziplinäre Künstlerin, deren Arbeit um Geste, Bewegung und den Körper in Aktion kreist. Seit über 25 Jahren erforscht sie den Körper als Ort des Erlebens und als Medium des Ausdrucks und untersucht, wie physische Erfahrung Identität und Wahrnehmung formt. Ausgehend von einer musikalischen Ausbildung erweiterte sie ihr Schaffen um Bildende Kunst, Design und Szenografie und entwickelte eine Sprache, die Klang, Bild und Performance verbindet. Sie hat an mehr als dreißig interdisziplinären Bühnenprojekten mitgewirkt und ihre bildnerischen Arbeiten in Ausstellungen in Quebec präsentiert. Ob in Performance oder Installation – Boulianne stellt den Körper stets ins Zentrum ihres künstlerischen Forschens und nutzt ihn als resonantes Instrument, um die Grenze zwischen innerem Erleben und kollektiver Präsenz zu hinterfragen.
Foto: Guillaume-Thibert
Chantale Boulianne & Sara Létourneau
What Still Whispers (Performance 27.11. / 20 Uhr)
What Still Whispers ist eine 50-minütige immersive Klangperformance und Installation von Sara Létourneau und Chantale Boulianne. Das Werk untersucht die Resonanzpunkte zwischen Körper, Material und Klang und entstand aus langjähriger Forschung zu den akustischen Eigenschaften unterschiedlicher Stoffe. Auf der Bühne arbeiten die Künstlerinnen mit monumentalen Klangobjekten und modularen Strukturen eigener Konstruktion und erzeugen dabei eindrucksvolle wie poetische Klang- und Bildereignisse.
Durch Gesten des Auf- und Abbaus entfalten sich physisch-intense Szenen, in denen der Körper selbst zum Instrument wird. Klangliches Material entsteht live aus resonanten Konstruktionen, akustischen Verstärkern und digitaler Klangbearbeitung und wird über ein achtkanaliges Lautsprechersystem im Raum verteilt. Die Szenografie verändert sich fortlaufend: Skulpturale Elemente greifen ineinander, lösen sich wieder und bilden wechselnde Architekturen mit symbolischer und klanglicher Bedeutung.
Texte, inspiriert von persönlichen Erfahrungen, öffnen sich zu universellen Fragen nach Wandel, Verletzlichkeit und Widerstandskraft. Sie sprechen von der Notwendigkeit, Beziehungen zur Welt neu zu denken und aufzubauen. What Still Whispers ist zugleich poetisch und roh – eine Reflexion über Erneuerung und die fragile Balance zwischen Zerstörung und Schöpfung. Es fragt, wie wir den Stimmen lauschen können, die im Wandel weiterflüstern.
Sara Létourneau ist eine multidisziplinäre Künstlerin, die in den Bereichen Bildende Kunst, Musik, Performance, Video und Theater arbeitet. Charakteristisch für ihre Praxis ist ihre Hybridität und die häufige Zusammenarbeit mit anderen Künstler*innen, wodurch Werke entstehen, die die Grenzen zwischen den Disziplinen auflösen. Der performative Aspekt steht im Zentrum ihres Schaffens: Über den bewegten Körper untersucht sie die Resonanzen von Klang, Geste und Material. Ihre Performances verwandeln Räume in immersive Umgebungen, in denen Symbole und Mythologien neue Wahrnehmungsweisen eröffnen. Seit 2006 hat sie mehr als hundert Arbeiten in Museen, Galerien, Theatern, Künstlerhäusern und Festivals in Kanada, den USA, Europa und Asien gezeigt. Neben ihrer Solopraxis ist sie auch in kollektiven Projekten aktiv, die Klang, Szenografie und körperliche Präsenz verbinden.
Chantale Boulianne ist eine multidisziplinäre Künstlerin, deren Arbeit um Geste, Bewegung und den Körper in Aktion kreist. Seit über 25 Jahren erforscht sie den Körper als Ort des Erlebens und als Medium des Ausdrucks und untersucht, wie physische Erfahrung Identität und Wahrnehmung formt. Ausgehend von einer musikalischen Ausbildung erweiterte sie ihr Schaffen um Bildende Kunst, Design und Szenografie und entwickelte eine Sprache, die Klang, Bild und Performance verbindet. Sie hat an mehr als dreißig interdisziplinären Bühnenprojekten mitgewirkt und ihre bildnerischen Arbeiten in Ausstellungen in Quebec präsentiert. Ob in Performance oder Installation – Boulianne stellt den Körper stets ins Zentrum ihres künstlerischen Forschens und nutzt ihn als resonantes Instrument, um die Grenze zwischen innerem Erleben und kollektiver Präsenz zu hinterfragen.
Foto: Constantin Monfilliette
Cosmic Bride
Hidden Gem (29.11. / 20 Uhr)
Hidden Gem ist eine fünfteilige Suite von Cosmic Bride, die sich als immersives Konzerterlebnis entfaltet, in dem sich Stimme, Harfe, Vibraphon und Elektronik wie Himmelskörper im Raum bewegen. Jedes Stück ist choreografiert, um die Zuhörenden in eine dreidimensionale Klangwelt hineinzuziehen, in der sich Performance, Installation und Ritual überlagern.
Der Titel bezieht sich auf die Hidden Gem – das weltweit erste Schiff zur Förderung polymetallischer Knollen, das kürzlich im Rotterdamer Hafen umgerüstet wurde. Das Werk verbindet industrielle Realität mit mythischer Metapher und reflektiert die neue „Goldgräberstimmung“ unserer Zeit: die Suche nach seltenen Schätzen in den Tiefen des Meeres – und die Frage, welche Spuren wir dabei hinterlassen.
Mit komplexen Vokaltexturen, metallischen Resonanzen und feinen elektronischen Strömungen erschafft Cosmic Bride eine Klanglandschaft, die zugleich intim und kosmisch wirkt. Hidden Gem lädt das Publikum ein, sich im Klang zu bewegen, aus wechselnden Perspektiven zu hören und jenen sensiblen Raum zu betreten, in dem Erforschung und Ehrfurcht einander berühren.
Cosmic Bride ist das Avant-Pop-Projekt der in Litauen geborenen Komponistin, Sängerin und Produzentin Natalja Chareckaja, die seit 2015 in der niederländischen Performing-Arts-Szene aktiv ist. In ihren Arbeiten verbindet sie zeitgenössische Komposition, jazzinspirierte Harmonien und experimentellen Pop zu immersiven Klangarchitekturen, in denen sich Musik und Raum miteinander verweben. Mit einem Hintergrund in Musiktheater, Performance und elektroakustischer Komposition erforscht Chareckaja, wie Stimme und Bewegung Wahrnehmung und Nähe gestalten. Unter dem Namen Cosmic Bride erschafft sie mehrdimensionale Performances, in denen Musik zugleich Landschaft und Erzählung wird – ein Erlebnis zwischen dem Planetarischen und dem Persönlichen.
Foto: Cveti Zabiela
Nora Frohmann
colors in the sky
Die ortsspezifische Installation „colors in the sky” besteht aus hängenden Objekten, die mit ihrer Transparenz, Farbigkeit und organischen Form an Algen, Fischschwärme und Tänze denken lassen. Die Bewegung der Betrachter:innen versetzt die Elemente in Schwingung, wodurch sich subtil die Komposition verändert. Die Farbverläufe erwecken den Eindruck außergewöhnlicher Farberscheinungen am Himmel: Sonnenaufgang, Abendrot, Regenbögen oder Aurora borealis.
Nora Frohmann lebt und arbeitet in Leipzig. Nach einem Studium der Fotografie in München und der Bildenden Kunst in Leipzig fußt ihre künstlerische Praxis auf Tanz/Performance und Skulptur/Installation. Dabei interessieren sie Potenziale, Uneindeutigkeiten, Körper- und Sinnlichkeit. Sie erhielt zahlreiche Stipendien und ihre Arbeiten werden international gezeigt. Seit 2017 ist sie Mitglied der Company des Leipziger Tanztheaters und dort seit 2019 künstlerische Assistentin. Sie arbeitet(e) mit/für verschiedene Choreograf:innen und Künstler:innen. Seit 2020 ist sie Teil der Leipziger Feedbackinitiative „you are warmly invited“. Ein weiteres ihrer zahlreichen Beschäftigungsfelder ist Kunstvermittlung.
Foto: Nora Frohmann
Max Burstyn, Yongbom Lee, Babett Niclas & Agata Patyczek
Interoception – Translating Bodily Signals into Sound (27.11. / 20 Uhr)
Interozeption ist die Wahrnehmung innerer Körperprozesse wie Herzschlag, Atmung, Hunger oder innere Anspannung. Sie beeinflusst maßgeblich unser emotionales Erleben und Selbstempfinden. Wie gut wir diese Signale spüren, prägt unsere Verbindung zu uns selbst – körperlich, geistig, musikalisch. Was wir „Welt“ nennen, beginnt in uns. In Interoception begegnen sich Musik und Wissenschaft nicht zur Illustration, sondern in einem echten Austausch. Die Musikerinnen geben im wahrsten Sinne ihr Innerstes preis. Mithilfe tragbarer EEG- und EKG-Systeme werden ihre Hirnströme und Herzsignale in Echtzeit erfasst. Was sonst verborgen und unhörbar bleibt wird zu Klang. Puls und neuronale Impulse bestimmen das Tempo und Dynamik. Die Musik folgt dem Körper – und der Körper beginnt widerum zu antworten. Atmung, Anspannung, Konzentration: Jeder innere Zustand hat hörbare Konsequenzen. Die Wahrnehmung wird gespiegelt, verstärkt, verformt und der Körper reagiert auf das, was er selbst hervorgebracht hat.
Interoception ist weder klassisches Konzert noch wissenschaftliches Experiment – sondern eine poetische Versuchsanordnung über das, was uns bewegt, im wörtlichsten Sinn. Musik, die nicht nur gehört, sondern gespürt wird.
Agata Patyczek ist Kognitionsneurowissenschaftlerin und Geigerin. Sie promoviert am Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig sowie am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin. Ihre Forschung untersucht, wie Signale aus dem Herzen mit der Gehirnfunktion interagieren. Sie ist leidenschaftliche Wissenschaftskommunikatorin und bringt Wissenschaft und Kultur näher zusammen.
Babett Niclas ist Harfenistin und entwickelt interdisziplinäre Projekte und neue Kulturformate.
Auf der Harfe sucht sie nach dem Klang, der dem Instrument wirklich eigen ist, und bespielt neben der klassischen Pedalharfe auch die barocke Tripleharfe. Neben ihren Ensembles Duo L’Oro, Soundtravelers, Sospiratem und GEM arbeitete Babett u. a. mit Florentina Holzinger, Continuum Berlin und der Lautten Compagney.
Yongbom Lee ist ein in Leipzig lebender koreanischer Komponist und interdisziplinärer Künstler, der Musik, Neurowissenschaft und visuelle Kunst miteinander verbindet. Seine Werke – von Instrumentalmusik über Elektronik bis hin zu Theatermusik – wurden u. a. vom Ensemble Modern und dem ORF Radio-Symphonieorchester Wien aufgeführt. Er ist mehrfach ausgezeichneter Preisträger in Europa und unterrichtet an der Hochschule für Musik und Theater Leipzig.
Max Burstyn ist Master-Absolvent der Royal Academy of Music in London. Seine interdisziplinäre Laufbahn umfasst Filmmusikkomposition für Disney, audiovisuelle Softwareentwicklung in der Neurowissenschaft an der UCL, sowie Live-Elektronik bei Clubs und Festivals.
Foto: Shin Joong Kim
Foto: Adam Markowski
Foto: Laura Mayer
Foto: Max Burstyn
Shasha Chen
Identity Factory (28.11. / 20 Uhr)
Identity Factory ist ein gemeinsames Projekt der Komponistin und Performerin Shasha Chen und der bildenden Künstlerin Qingyuan Wang, das den virtuellen Audio-Performance-Raum als lebendigen Organismus begreift. In dieser Umgebung interagieren Bildschirme, Klang und performative Elemente wie miteinander verbundene „Organe“ in einem dynamischen Zusammenspiel.
Als Teil von Chens laufender Werkreihe fe-[mute(male)] untersucht das Stück die Reproduktion, Kommerzialisierung, Zirkulation und Konsumtion des weiblichen Körpers als Simulakrum. Auf performativer und audiovisueller Ebene hinterfragt Identity Factory, wie Geschlecht, Identität und Körperlichkeit durch soziale und systemische Strukturen geformt und dargestellt werden.
Das Werk verbindet 3D-Audio, Video und performative Ansätze und bewegt sich an der Schnittstelle zwischen Installation und Performance. Die visuelle Gestaltung von Qingyuan Wang (Video) und Lilai Jia (Animation) erweitert den Klang in einen virtuellen Raum, während Chens kompositorisches Konzept das Publikum in eine immersive Reflexion über Körper, Identität und Wahrnehmung führt. Der Körper selbst wird dabei zum Medium, zum Symbol und zum Ort der Transformation.
Shasha Chen ist Komponistin, Performerin und Multimedia-Künstlerin. In ihrer Arbeit verbindet sie kompositorische, interdisziplinäre und kollaborative Ansätze im Rahmen eines konzeptuellen (neuen) Musiktheaters, um gesellschaftspolitische Themen wie Identität, Geschlecht, Machtstrukturen, Patriarchat, soziale Ungerechtigkeit, Migration und Gewalt zu untersuchen.
Sie ist DAAD Artists-in-Berlin Fellow 2026, Preisträgerin des Internationalen Hanns Eisler Stipendiums der Stadt Leipzig 2025 sowie SANE-Projekt-Residenzkünstlerin in Kooperation mit Hellerau und Echo Factory. Zudem erhielt sie den Presser Music Award 2024 und ein Stipendium der Art Omi Residency.
Ihre Musik und Performances wurden u.a. bei den Wiener Festwochen, dem TIME:SPANS Festival, MaerzMusik, Forecast Forum, Phoenix Satellite, dem Hamburg International Music Festival, dem impuls Festival und dem Linecheck Music Meeting & Festival präsentiert. Ihre Werke wurden außerdem in Museen und Galerien weltweit ausgestellt.
Foto: Shasha Chen & Qingyuan Wang
Luis Kießling
59°05’13.3 N 78°59’40.4 E (Kinetische Soundinstallation)
Im Rahmen einer zehnminütigen Vorführung tauchen sieben unterschiedlich große Orgelpfeifen mit Klangkörpern in ein Becken mit 800 Litern Wasser ein. Das Eintauchen erfolgt nach dem Zufallsprinzip und erzeugt so ständig wechselnde Klangkompositionen. Nach Ablauf der zehn Minuten kehren die Klangkörper in ihre Ausgangsposition zurück. Anschließend folgt eine Pause, die zufällig zwischen zwei und fünf Minuten variiert. Danach beginnt der Ablauf erneut und entwickelt selbstständig ein weiteres Stück. Die Orgelpfeifen sind mit Schnüren an einer Deckenplatte befestigt, die auch die sichtbaren Motoren und die übrige Technik trägt. Dies macht die mechanischen Elemente zu einem erkennbaren Teil des Objektes. Die Raumakustik wird unmittelbar von der Installation geprägt. Die Klänge der Orgelpfeifen verbinden sich mit dem Plätschern und den Bewegungen des Wassers sowie mit Geräuschen der Motoren, der Schnüre und ihrer Reibung.
Luis Kießling wurde 2001 in Halle (Saale) geboren. Eine Stadt in Sachsen-Anhalt, die vom Strukturwandel, kulturellen Gegensätzen und einer stillen Eigenart geprägt ist. Seit 2022 studiert er an der Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle, aktuell in der Klasse Zeitbasierte Künste bei Prof. Michaela Schweiger. Der Fokus seiner künstlerischen Praxis liegt auf Sound, Installation und kinetischen Installationen.
Foto: Luis Kießling
Stijn Dickel
A Chorus of Footsteps (28.11. / 17 Uhr)
A Chorus of Footsteps ist ein kollektiver Hörspaziergang, der untersucht, wie unsere individuellen und gemeinsamen Bewegungen die Klanglandschaft um uns herum prägen. Jeder Schritt, jede Oberfläche und jeder Rhythmus wird Teil einer Komposition in Bewegung – geschaffen nicht von einem einzelnen Künstler, sondern von allen, die gemeinsam zuhören und sich bewegen.
Der von Stijn Dickel von aifoon entwickelte Spaziergang lädt die Teilnehmer dazu ein, das Gehen als auditiven, räumlichen und sozialen Akt zu erleben. Das Zuhören wird zu einer Form der Choreografie: eine Möglichkeit, die Welt durch Klang zu spüren und neu zu imaginieren.
In der begleitenden Lecture Talk stellt Dickel die künstlerische Praxis von aifoon und The Swarm vor – ein tragbares, kabelloses Lautsprechersystem, das entwickelt wurde, um Klang frei durch den Raum wandern zu lassen. Die Demo zeigt, wie dieses Instrument immersive, räumliche Hörerlebnisse ermöglicht und alltägliche Umgebungen in resonante Begegnungsräume verwandelt.
Stijn Dickel studierte Philosophie und Mixed Media und begann seine künstlerische Laufbahn als Performer und Musiker mit Jan Fabre/Troubleyn in Je suis sang. Bald darauf entwickelte er Klangkompositionen und Hörkonzepte für Tanz, Theater, Zirkus und Dokumentarfilm und arbeitete als Musiker unter anderem mit Ensembles wie Kaboom Karavan und Inwolves zusammen.
Seit über zwanzig Jahren ist er künstlerischer Leiter von aifoon, einer nomadischen Kunstorganisation, die das Zuhören als kritische und ko-kreative Praxis versteht. Seine künstlerische Arbeit bewegt sich an der Schnittstelle zwischen der Choreografie des Klangs und der Szenografie des Hörens. Durch partizipative Projekte im öffentlichen Raum erforscht er, wie Zuhören soziale, kulturelle und urbane Dialoge prägen kann.
Fasziniert von den Klängen, die wir mental und körperlich in uns tragen, schuf er Werke wie Watch Out!, Watch In!, A glimpse of where we’re going und Murmur, in denen das Tragen von Klang und die Erweiterung des Hörakts zentral sind. Mit A Chorus of Footsteps und dem hauseigenen Soundsystem De Zwerm führt er seine Forschung zu Klangidentität und akustischem Territorium weiter.
Foto: Stijn Dickel
Stijn Dickel
Lecture (27.11. / 18 Uhr)
In diesem Vortrag werden die Teilnehmer dazu eingeladen, das Zuhören als einen aktiven und mitgestaltenden Prozess zu betrachten, der die Art und Weise prägt, wie Menschen zusammenleben. Stijn Dickel stellt die künstlerische Praxis von Aifoon vor und stützt sich dabei auf Geschichten, Klangfragmente und partizipative Projekte – von Soundwalks und Zirkusvorstellungen bis hin zu „The Swarm“, einem beweglichen Orchester aus zwanzig drahtlosen Lautsprechern. Anhand dieser Beispiele veranschaulicht der Vortrag, wie das Zuhören die Wahrnehmung, Beziehungen und sogar städtische Räume verändern kann. Eine Live-Demonstration von „The Swarm“ ermöglicht es den Teilnehmern zu erleben, wie dieses Instrument immersive, räumliche Hörumgebungen schafft und alltägliche Umgebungen in gemeinsame Begegnungsräume verwandelt. Der Vortrag zeigt, wie sich dieses einzigartige System aus einer künstlerischen Notwendigkeit zu einem vielseitigen Werkzeug für Workshops, Installationen, Performances und Hörspaziergänge entwickelt hat.
Stijn Dickel studierte Philosophie und Mixed Media und begann seine künstlerische Laufbahn als Performer und Musiker mit Jan Fabre/Troubleyn in Je suis sang. Bald darauf entwickelte er Klangkompositionen und Hörkonzepte für Tanz, Theater, Zirkus und Dokumentarfilm und arbeitete als Musiker unter anderem mit Ensembles wie Kaboom Karavan und Inwolves zusammen.
Seit über zwanzig Jahren ist er künstlerischer Leiter von aifoon, einer nomadischen Kunstorganisation, die das Zuhören als kritische und ko-kreative Praxis versteht. Seine künstlerische Arbeit bewegt sich an der Schnittstelle zwischen der Choreografie des Klangs und der Szenografie des Hörens. Durch partizipative Projekte im öffentlichen Raum erforscht er, wie Zuhören soziale, kulturelle und urbane Dialoge prägen kann.
Fasziniert von den Klängen, die wir mental und körperlich in uns tragen, schuf er Werke wie Watch Out!, Watch In!, A glimpse of where we’re going und Murmur, in denen das Tragen von Klang und die Erweiterung des Hörakts zentral sind. Mit A Chorus of Footsteps und dem hauseigenen Soundsystem De Zwerm führt er seine Forschung zu Klangidentität und akustischem Territorium weiter.
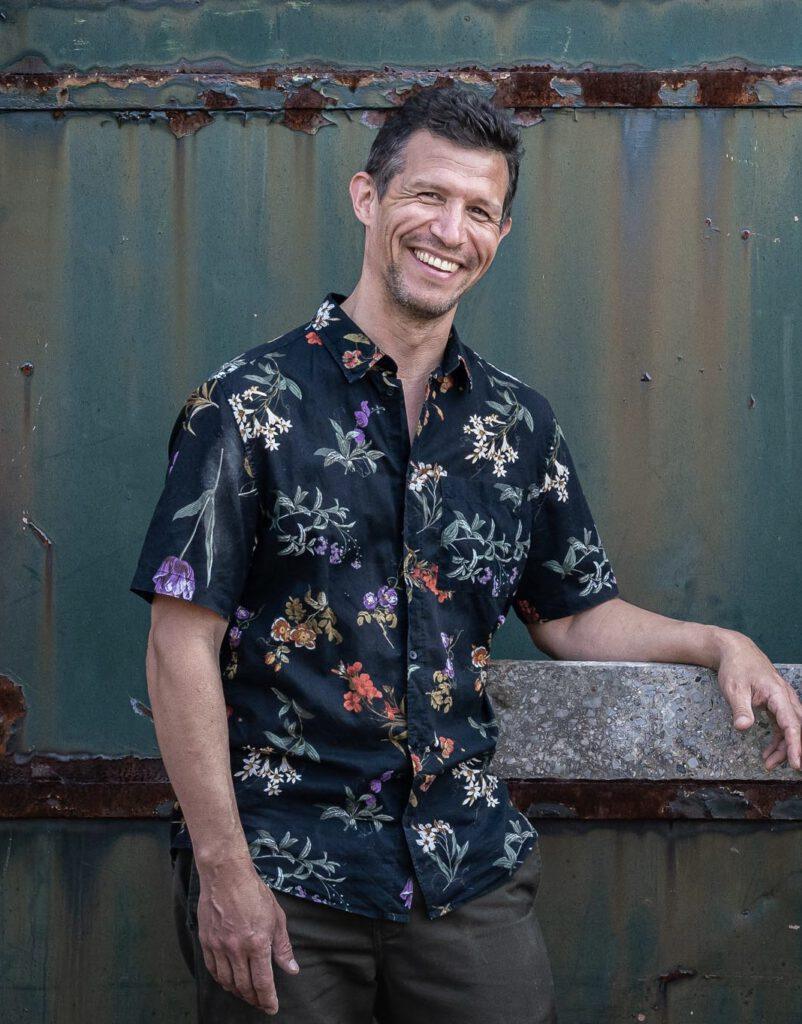
Foto: Tom Cornille
Sabina Covarrubias
Konzert (26.11. / 19 Uhr)
Sabina Covarrubias präsentiert eine audiovisuelle Performance im Kontext des sens, die sich mit der Echtzeit-Visualisierung von Musik beschäftigt. Mithilfe selbst entwickelter Software und interaktiver Systeme übersetzt sie die Energie und Struktur des Klangs in bewegte Bilder, sodass das Publikum musikalische Prozesse nicht nur hört, sondern auch visuell erlebt.
Im Zentrum steht ihre eigens entwickelte Software Synesthetic Devices, ein für Ableton Live konzipiertes Umfeld, das generatives Video mit Live-Klangsynthese verbindet. Modulare Synthesizer, Stimmprozessoren und Echtzeit-Animationssysteme greifen dabei ineinander, wodurch sich Klang und Bild gegenseitig beeinflussen. Die Performance entfaltet sich als fortlaufender Dialog zwischen akustischen und visuellen Ebenen, in dem Farbe, Rhythmus und Textur zu gemeinsamen Ausdrucksträgern werden.
Mit der Verbindung von künstlerischer Intuition und technischer Präzision eröffnet die Performance neue Perspektiven auf die visuelle Dimension musikalischer Erfahrung. Das Werk macht die verborgenen Strukturen des Klangs sichtbar und verwandelt das Konzert in eine immersive, synästhetische Umgebung zwischen Wahrnehmung, Technologie und Emotion.
Sabina Covarrubias, PhD, ist Komponistin, Multimedia-Künstlerin und Softwareentwicklerin. In ihrer Arbeit erforscht sie die Schnittstelle von Musik und visueller Darstellung. Sie ist Gründerin von Synesthetic Devices, einer Reihe visueller Musikinstrumente für Ableton Live, und realisiert in Echtzeit generierte audiovisuelle Performances mit modularen Synthesizern, Stimmprozessoren und generativen Video-Engines.
Ihr künstlerisches Spektrum reicht von visueller Musik über elektroakustische und experimentelle elektronische Musik bis hin zu musique mixte und sinfonischer Komposition. Ihre Arbeiten wurden unter anderem im Tate Modern (London), bei Vision’R (Paris), Sonica (Glasgow), Saturnalia (Mailand), Keroxen (Teneriffa), Mercat de Música Viva (Vic), Improtech (Uzeste), Performing Media Festival (Indiana) und Festival de l’Imaginaire (Paris) präsentiert.
Covarrubias erhielt das SNCA-Stipendium des mexikanischen Kulturministeriums, promovierte an der Université Paris 8, lehrte an der Sorbonne und Paris 8 und arbeitete am IRCAM, wo sie KI-basierte Werkzeuge zur musikalischen Visualisierung entwickelte.
Foto: Bernard Bousquet
Anouk Kruithof
Universal Tongue
video edition, 2022 / 4 hours duration with sound / edited with Ieva Maslinskaitė / soundtrack with Karoliina Pärnänen
Twerking, Vogue, Fortnite, Flashmobs, Sufi oder Reise nach Jerusalem. Die bildende Künstlerin Anouk Kruithof ist fasziniert von Tanz als Form des Selbstausdrucks und der Selbstermächtigung, was sie dazu veranlasst hat, Tanzstile aus aller Welt zu erforschen. Das Tanzkonklave und Video Universal Tongue führt uns durch den Dschungel des Internets. Es untersucht, wie sich Tanz im Laufe der Geschichte als Teil unserer globalen Medienkultur entwickelt hat und wie er sich online manifestiert. Die Videoausgabe Universal Tongue ist eine Zusammenstellung von gefundenem Videomaterial, das Tausende verschiedener Tanzstile präsentiert und von einem Team von 52 Forschern aus aller Welt aus YouTube, Facebook und Instagram ausgewählt wurde. Insgesamt sammelten sie 8800 Videos, 250 Stunden Videomaterial und 1000 Tanzstile aus allen 196 Ländern der Welt. Dieses vierstündige mitreißende Tanzvideo ist gebündelt und nach dem Rhythmus des Soundtracks arrangiert, der teilweise aus Originalmusik aus den gefundenen Videos remixt wurde. Die fortlaufende Schleife bewegter Bilder hebt typische Kategorien der Weltordnung wie Land, Kontinent oder Kultur auf. Stattdessen betrachtet sie unsere Ära der Fluidität, Hybridität und ununterbrochenen Vernetzung mit Respekt und Wertschätzung für unsere vielfältigen historischen Hintergründe, kulturellen Unterschiede und einzigartige Individualität.
„Tanz – der sich bewegende Körper – verbindet uns mehr als alles andere in unserer vielfältigen und komplexen Welt in der Erkenntnis unserer gemeinsamen Zerbrechlichkeit und unserer gemeinsamen menschlichen Existenz. Er weist uns auch auf die Möglichkeit einer integrativeren Welt hin, in der es einen grenzenlosen Austausch und ein Verständnis für neue Identitäten gibt, eine Welt, in der einfach jeder ein Tänzer ist.“ — Anouk Kruithof
Anouk Kruithof (b. 1981, Dordrecht, The Netherlands) ist eine bildende Künstlerin mit einem transdisziplinären Ansatz, der Fotografie, Skulptur, Collage, Video, Websites und (soziale) Interventionen umfasst. Sie lebt in Berlin und zeitweise in Botopasi, Suriname. Kruithof hatte Einzelausstellungen im Centro de la Imagen in Mexiko-Stadt, im Stedelijk Museum und im FOAM in Amsterdam. Ihre Arbeiten sind auch in den Sammlungen des MoMA San Francisco, des Museums Folkwang in Essen, des Bonnefanten in Maastricht und des Museums Voorlinden in Wassenaar vertreten. Universal Tongue wird nach wie vor intensiv weltweit gezeigt und wurde im MAS Antwerpen, im Museum Tinguely in Basel, in der Kunsthal Rotterdam und beim WHOLE | United Queer Festival in Ferropolis, Gräfenhainichen, Deutschland, ausgestellt.
Bild: Screenshot Universal Tongue
Tomoko Nakasato, Juliane Zöllner, Cheetah Dragon, Jakob Gruhl
WAHN♥SINN / everyday insanity (28.11. / 20 Uhr)
Die Performance verbindet Elemente interaktiver Lesung, Performance und Konzert. Sie thematisiert Dystopien des Alltags, Beobachtungen und Verbindungen zwischen Menschen – online, offline und dazwischen. Wesentliches Stilmittel ist das Tracking der Performer:innen Tomoko Nakasato und Juliane Zöllner. Ihre Bewegungen und Positionen im Raum interpretieren die Soundscapes von Jakob Gruhl sowie die elektronischen Stücke von Cheetah Dragon.
Tomoko Nakasato aus Japan begann in den 90er Jahren mit Hip-Hop-Streetdance und kombiniert diese Erfahrung mit zeitgenössischen Tanztechniken. Seit 2008 lebt und arbeitet sie in Berlin. Von 2011 bis heute hat sie international mit Menschen wie Ilpo Väisänen (Pan sonic, the Angel), Jochen Arbeit (Einstürzende Neubauten), Damo Suzuki (Ex-Can) und Frank Bretschneider (Raster-Noton) zusammengearbeitet.
Juliane Zöllner wurde 1981 in Dresden geboren, initiierte bereits im Studium Theater- und Performanceprojekte und schloss den Master „Literarisches Schreiben“ am Literaturinstitut Leipzig ab. Seither arbeitet sie als freie Autorin und ist Teil der Leipziger Contact Szene. Zuletzt präsentierte sie in einer szenischen Lesung mit Sébastien Branche und Franz Sodann Sophie Steinbecks Text „Mein Geliebter“ im Theatergarten des Neuen Schauspiels.
Cheetah Dragon alias Stephan Kloß ist Musiker, Medienkünstler und Entwickler. Er studierte Multimediadesign an der Burg in Halle und erforschte und entwickelte multisensitive, musikalische Experiences. Für seine Arbeit Mazetools Soniface erhielt er den ZKM App Art Award. Als Musiker arbeitet er mit seinen selbst entwickelten Tools, unter dem Pseudonym Cheetah Dragon veröffentlicht er elektronischen R&B mit Hyperpop Elementen.
Jakob Gruhl ist Museologe, Musiker und sorbischer Künstler. Er ist Mitentwickler der Software-Tools Sonic Moves und Mazetools, die multisensorische Ansätze mit künstlerischen und musikalischen Ausdrucksformen verbinden, insbesondere durch Motion Tracking. Als Künstler arbeitet er unter dem Namen jkube (dʒeɪ kuːb) in den Bereichen Ambient, Techno und Electronica.
Foto: Nina Buttendorf
Britt Hatzius
MOVING OUT LOUD (30.11. / 13–16 Uhr)
MOVING OUT LOUD ist eine Erfahrung von Tanz ohne Sehsinn. Mitten auf der Bühne und in kleinen Gruppen taucht das Publikum mit geschlossenen Augen in eine Klanglandschaft aus Stimmen, Beschreibungen und sich bewegenden Körpern ein, die spielerisch den eigenen Körper, Bewegung und Tanz rein akustisch erfahrbar macht. Gemeinsam mit blinden sowie sehenden Tänzer*Innen entwickelt, beschäftigt sich die Performance künstlerisch mit (Selbst-)Audiodeskription und den Möglichkeiten von empathischer Resonanz, wenn Tanz vor allem akustischen wahrgenommen wird.
In der Begegnung unterschiedlicher Protagonist*Innen, Stimmen und Körpern geht es hier um eine spielerische Auseinandersetzung mit der Frage nach Erfahrbarkeit von Bewegung über den visuellen Aspekt von Tanz hinaus. Inmitten der hörbaren Bühnenpräsenz von Tänzer*Innen und ohne visuelles Vorbild öffnet sich dem Publikum eine ganz individuelle Vorstellung von Tanz und Körperwahrnehmung. Basierend auf der Unterrichtsmethode der blinden Balletttänzerin Krishna Washburn, die mit Selbst-Audiodeskription in ihren online Dark Room Ballet Workshops arbeitet, erkundete Britt Hatzius gemeinsam mit der blinden Performerin Pernille Sonne, der blinden Sängerin Gerlinde Sämann, den sehenden Tänzer*Innen Cecilia Ponteprimo, Livia Vogt, Lorenzo Ponteprimo und Georgia Begbie das akustische Potential von Tanz. Diese gemeinsame Erkundung wird nun mit Hilfe der immersiven Toninstallation OTTOsonics für ein sehendes sowie nichtsehendes Publikum zugänglich.
Britt Hatzius, geboren 1978 in Chiclayo Peru, arbeitet mit Film, Video, Sound und Performance. Sie studierte Medien und Bildende Kunst am Chelsea College of Arts London und Soziologie am Goldsmiths University of London. Im Zentrum ihrer Arbeit stehen meist Bewegtbild-Formate welche die Interpretation von Sprache und das damit verbundene Potenzial für Fehlkommunikation erkunden.
Sie ist Teil des Kollektivs Not Applicable und der gemeinnützigen Organisation Vision Inclusive.
Der Workshop ist ein Konzept von Britt Hatzius, entwickelt in enger Zusammenarbeit mit den Tänzer*innen Krishna Washburn, Pernille Sonne, Cecilia Ponteprimo, Gerlinde Sämann, Livia Vogt, Lorenzo Ponteprimo, Georgia Begbie und der Dresden Frankfurt Dance Company unter der künstlerischen Leitung von Ioannis Mandafounis. Dramaturgie: Charlotte Arens. Outside Ear: Melanie Hambrecht, Lenka Löhmann, Sanatha Hannig und Thomas Tajo. Ton und Soundbearbeitung: Britt Hatzius, Felix Deufel und Rupert Jaud. Ambisonic-Tontechnik (OTTOsonics): Manu Mitterhuber. Künstlerische Produktion: Katja Timmerberg. Koproduziert von Theater Rampe e.V. Stuttgart mit Unterstützung der Schwankhalle Bremen und des EinTanzHaus e.V. Mannheim. Ermöglicht durch die Projektförderung des Landesverbands Freie Tanz- und Theaterschaffende Baden-Württemberg (LaFT BW) e.V., gefördert vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg. Zusätzlich unterstützt vom Fonds Darstellende Künste aus Mitteln der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien.
Foto: Dominique Brewing
Robert Wechsler
The MotionComposer (Workshop 28.11. / 14 Uhr)
The MotionComposer ist ein interaktives Tanz- und Musiksystem, das Bewegung in Klang verwandelt. Entwickelt, um Menschen mit unterschiedlichen körperlichen und kognitiven Fähigkeiten das Musizieren durch Bewegung zu ermöglichen, verwandelt es selbst kleinste Gesten in klangliche Ereignisse voller Ausdruckskraft. Das von Robert Wechsler, Philipp Schmalfuss und ihrem Team entwickelte Instrument eröffnet neue kreative Möglichkeiten für Tänzerinnen, Musikerinnen und alle, die das Zusammenspiel von Körper und Klang erforschen möchten.
In dieser Live-Demonstration und Workshop können Teilnehmende den MotionComposer selbst ausprobieren. Mithilfe von Bewegungssensoren und Echtzeit-Klangsynthese reagiert das System auf Haltung, Rhythmus und Dynamik – und lässt Bewegung zu Musik werden.
Die Session stellt die neuesten Funktionen des MotionComposer vor und zeigt seine Anwendung in inklusiver Kunst, Therapie und Bildung. Durch die Verbindung von Technologie und menschlichem Ausdruck wird erfahrbar, wie Barrierefreiheit neue Dimensionen von Kreativität und gemeinschaftlichem Erleben eröffnet.
The MotionComposer ist ein interaktives Musikinstrument, das Bewegung in Klang verwandelt. Entwickelt wurde es von Robert Wechsler, Philipp Schmalfuss und weiteren Mitwirkenden mit dem Ziel, die Freude und die gesundheitsfördernde Wirkung des Musizierens Menschen aller Fähigkeiten zugänglich zu machen. Das MotionComposer-Team hat seinen Sitz in Weimar und Chemnitz.
Der Choreograf und Tänzer Robert Wechsler gilt als Pionier interaktiver Technologien in den darstellenden Künsten. Nach seinem Studium bei Merce Cunningham und John Cage in New York gründete er Palindrome, eine Tanzkompanie, die sich der Verbindung von Bewegung und digitalen Medien widmet.
Der Komponist Philipp Schmalfuss, ehemaliger Student der Bauhaus-Universität Weimar, ist auf die Software PureData spezialisiert und entwickelte viele der musikalischen Umgebungen, die heute Teil des MotionComposer sind.
Lecture (28.11. / 18 Uhr)
Der Vortrag bietet eine Einführung in den The MotionComposer , ein interaktives Tanz-Musik-System, das Bewegung in Klang übersetzt. Das von Robert Wechsler, Philipp Schmalfuss und ihrem Team entwickelte Instrument ermöglicht es, durch Bewegung Musik zu gestalten – von feinsten Gesten bis zu dynamischen Körperabläufen. Die Teilnehmenden erfahren im Rahmen des Vortrags, wie der MotionComposer mittels Bewegungssensoren und Echtzeit-Klangsynthese auf Haltung, Rhythmus und Bewegungsfluss reagiert und daraus ein expressives Klanggeschehen formt. Der Vortrag beleuchtet zudem die technischen und musikalischen Ansätze hinter dem System – von den Synthesizer-Engines bis zu den Prinzipien der Musikprogrammierung –, die es ermöglichen, physische Gesten in hörbare Ausdrucksformen zu übersetzen.
Foto: Uwe Meinhold
La Lvcha
DJ Set (29.11.)
„My mission is to serve humanity by sharing music as medicine.“
Ihre kompromisslos eklektischen Sets verbinden traditionelle Rhythmen und futuristische Beats und verweben Afro House, Electro Cumbia, Salsa Breaks, World Beats, Tropical Disco, Downtempo und Folktronica zu einem Klangteppich, der die Seele berührt, den Körper befreit und zu einer kollektiven Feier in hoher Schwingung einlädt.
Foto: La Lvcha
Paul Hauptmeier & Clara Sjölin
String Theory 2 (29.11. / 20 Uhr)
Für eine Tänzerin, 3D-Sound, Laser, Positionsbestimmung, Bewegungsaufnahme, kapazitive Berührungssensoren, Metallstränge und Max/MSP.
„String Theory 2” ist ein interaktives musikalisches Ökosystem, das von Paul Hauptmeier komponiert und von der Tänzerin Clara Sjölin aufgeführt wird. Das Stück ist in mehrere musikalische Situationen oder Landschaften gegliedert. In diesen nutzt die Tänzerin ihre Position, ihre Bewegungen und ihre gestische Interaktion mit Lasern und Metallsträngen, um die musikalischen Möglichkeiten des Systems in Echtzeit zu erkunden und gleichzeitig auf die Komposition zu reagieren, die sie mitgestaltet.
Das Ergebnis ist eine komplexe Rückkopplungsschleife zwischen der Handlungsfähigkeit der Tänzerin, der Offenheit und den Einschränkungen des musikalischen Systems, improvisierten Reaktionen und dem audiovisuellen Ergebnis, das das Publikum erlebt.
Paul Hauptmeier ist ein in Leipzig ansässiger Komponist und Multimedia-Künstler. Er studierte Komposition in Weimar und in San Diego, Kalifornien. Seit 2009 arbeitet er als Teil des Künstlerduos Hauptmeier|Recker im Bereich Komposition, Klang- und Multimedia-Kunst. Paul ist Gründungsmitglied des ZiMMT in Leipzig, wo er auf dem Gebiet der räumlichen Audiotechnik und Augmented Reality im Bereich Klang- und Multimedia-Kunst forscht und Workshops, Podiumsdiskussionen, Konzerte und Ausstellungen zu diesem Thema organisiert. Seine Werke wurden auf Festivals und in Institutionen wie der Sharjah Biennale, der Istanbul Biennale, der Biennale von Venedig, der Biennale Musica in Venedig, dem Festspielhaus Hellerau, Ses Dotze Naus Ibiza und EMAF präsentiert.
Clara Sjölin ist eine Tanzkünstlerin aus Schweden, die in verschiedenen lokalen Kontexten in Leipzig im Bereich Choreografie und Tanzpädagogik arbeitet. Claras wiederkehrende choreografische Themen untersuchen Formen des sozialen Miteinanders, Befreiung als kollektive und individuelle Manifestation und die Wiederbelebung historischer Ereignisse. Sie choreografiert für die Bühne und im öffentlichen Raum, für Gruppen und ihre eigenen Soloarbeiten. Seit 2024 ist Clara künstlerische Leiterin der Jugendtanzkompanie (Juniorcompany der Älteren) am Leipziger Tanztheater.
Foto: Matthias Gruner
YAAND & urbau
Concrete Fields (29.11. / 20 Uhr)
Die in Berlin lebenden Künstler Anda Kryeziu (YAAND) und Justin Robinson (Urbau) präsentieren Concrete Fields, ein gemeinsames Projekt, das Industrial Noise, Hyperpop-Ästhetik und räumliches Audiodesign miteinander verbindet.
Im Mittelpunkt der Arbeit stehen Field Recordings aus dem Kosovo und Brandenburg, die durch eine Kombination aus digitalen und semi-analogen Verarbeitungstechniken transformiert werden. Das Ergebnis ist ein lebhafter klanglicher Dialog zwischen dem Organischen und dem hypersynthetischen – eine Spannung, die sich durch rhythmisch komplexe Strukturen und glitch-artige Texturen entfaltet.
Mit einer Kombination aus Feldaufnahmen, Stimme, elektromagnetischen und Lavalier-Mikrofonen, digitalen Synthesizern und Samplern schaffen die Künstler immersive Klanglandschaften, die die Grenzen zwischen ländlich und industriell, natürlich und mechanisch, intim und architektonisch verschwimmen lassen.
Concrete Fields wird in einem räumlichen Live-Audio-Kontext aufgeführt und erkundet das sich wandelnde Terrain, in dem menschliche Präsenz, Technologie und Umwelt aufeinanderprallen – dabei reflektiert es, wie Klang den Raum erfüllt und wie wiederum der Raum unsere Wahrnehmung von Klang prägt.
Anda Kryeziu (YAAND), eine im Kosovo geborene und derzeit in Berlin lebende experimentelle Künstlerin, Produzentin, Komponistin und Performerin, verbindet markante zeitgenössische Kompositionen mit den Ästhetiken von Hyperpop und Electronica. Ihre Arbeiten sind geprägt von Glitch-Strukturen sowie einer bewussten Auseinandersetzung mit Dissonanz und Klangfragmentierung.
Ihre Musik wurde auf zahlreichen Festivals präsentiert, darunter das ECLAT Festival, die Münchener Biennale, die Darmstädter Ferienkurse, November Music, Warsaw Autumn, Dokufest und Klangspuren Schwaz.
Kryeziu erhielt mehrere Stipendien und Auszeichnungen, darunter den 69. Kompositionspreis der Stadt Stuttgart 2024, den Preis der Contemporary Arts Alliance Berlin sowie ein Stipendium der Akademie Musiktheater Heute der Deutschen Bank Stiftung.
Der in Berlin lebende Medienkomponist, audiovisuelle Künstler und Pädagoge Justin Robinson arbeitet in einem breiten Spektrum: von Kammermusik- und Orchesterkompositionen bis hin zu audiovisuellen Performances, die unter anderem bei der Biennale di Venezia und der Ars Electronica gezeigt wurden.
Unter seinem Künstlernamen urbau konzentriert er sich auf die Schnittstelle zwischen industriellen Klanglandschaften und Noise. Durch die intensive Verarbeitung klanglicher Quellen und elektronischer Synthese erschafft er Klangarchitekturen und reaktive Visualisierungen, die das Verhältnis zwischen industriellem Verfall und digitaler Abstraktion untersuchen.
Das Ergebnis sind delirische Verzerrungen und meditative Kompositionen, die miteinander kollidieren und verschmelzen – eine Ästhetik, in der das Digitale und das Materielle nahtlos ineinandergreifen.
Foto: Gael Delpero
Thomas Laigle
Luciférine
Luciférine ist eine skulpturale Klangperformance für biolumineszente Bakterien, die im ZiMMT als Installation zu erleben sein wird. Der Titel verweist auf das Molekül Luciferin, das die chemische Reaktion der natürlichen Meeresleuchtkraft ermöglicht. In völliger Dunkelheit verfolgt eine Gruppe von Menschen die Bewegung dieser leuchtenden Mikroorganismen, die sich in flüssiger Form durch eine gläserne Skulptur-Instrument bewegen.
Während die lebendige Flüssigkeit zirkuliert, zeichnet sie die Konturen eines chimärenhaften Wesens nach und erzeugt durch den Kontakt mit Sensoren vielschichtige Klänge. Die Skulptur wird so zu einer Schnittstelle zwischen Kunst und Leben – ein Spielraum für Bakterien, in dem Bewegung und Sauerstoff ihre Leuchtkraft nähren.
Mit Luciférine schafft Thomas Laigle ein immersives und kontemplatives Erlebnis, das eine Verbindung zu den Anfängen von Licht und Leben herstellt. Klangkunst, Skulptur und wissenschaftliche Forschung verschmelzen zu einer sinnlichen Expedition in die Tiefe – eine stille Reise in das geheimnisvolle Leuchten des Abgrunds.
Thomas Laigle ist ein Klang- und Medienkünstler mit Wohnsitz in Berlin und Frankreich. In seiner transdisziplinären Praxis erforscht er die Wechselwirkungen zwischen natürlichen Phänomenen, Technologie und Lebewesen. Licht und Klang sind in seinen Arbeiten häufig so eng miteinander verwoben, dass sie eine einzige, untrennbare Einheit bilden.
In einer kunstwissenschaftlichen Herangehensweise arbeitet Laigle mit Fachleuten aus Entomologie, Mikrobiologie und Ozeanologie zusammen. Aus diesen Kooperationen entstehen Werke, die unsere Wahrnehmung des Lebendigen erweitern und die verborgenen Verflechtungen des Lebens erfahrbar machen. Seine Klangskulpturen, Installationen und interaktiven Objekte folgen einer Low-Tech-Ästhetik, die Sinneserfahrung, Nachhaltigkeit und poetische Präzision in Balance bringt.
Foto: Romain Charrier
Alexander Schubert
Gestural Interfaces (Lecture 29.11. / 18 Uhr)
In seinem Vortrag „Gestural Interfaces“ untersucht Alexander Schubert das Verhältnis von körperlicher Bewegung und musikalischem Ausdruck im Kontext zeitgenössischer Komposition und Live-Elektronik. Auf Grundlage seiner künstlerischen Forschung und Lehrtätigkeit an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg thematisiert er, wie Gesten sowohl als kompositorische Werkzeuge als auch als Ausdrucksschnittstellen fungieren können.
Anhand von Beispielen aus seiner eigenen künstlerischen Praxis analysiert Schubert, wie Sensorik, Bewegungsdaten und interaktive Systeme menschliche Gestik in Klang übersetzen und dadurch hybride Formen zwischen Performance, Technologie und Körperlichkeit schaffen. Der Vortrag gibt Einblick in kompositorische Strategien, technische Setups und ästhetische Überlegungen, die entstehen, wenn der Körper des Interpreten selbst Teil des musikalischen Systems wird.
Der Vortrag verbindet theoretische Reflexion mit praktischen Ansätzen und zeigt, wie neue Technologien musikalische Autorschaft, performative Identität und Wahrnehmung im zeitgenössischen Musiktheater neu definieren können.
Alexander Schubert (1979) studierte Bioinformatik und Multimedia-Komposition. Er ist Professor an der Musikhochschule Hamburg. Schuberts Interesse gilt der Grenze zwischen der akustischen und der elektronischen Welt. In Musikkompositionen, immersiven Installationen und inszenierten Stücken untersucht er das Zusammenspiel zwischen Digitalem und Analogem. Er schafft Werke, die Testszenarien oder Interaktionsräume realisieren, die Wahrnehmungs- und Darstellungsweisen hinterfragen. Fortlaufende Themen in diesem Bereich sind Authentizität und Virtualität. Der Einfluss und die Rahmenbedingungen digitaler Medien auf ästhetische Sichtweisen und Kommunikation werden aus einer postdigitalen Perspektive untersucht. Aktuelle Forschungsthemen in seinen Arbeiten waren Virtual Reality, künstliche Intelligenz und online-vermittelte Kunstwerke. Schubert ist Gründungsmitglied von Ensembles wie „Decoder“. Seine Werke wurden in den letzten Jahren mehr als 700 Mal von zahlreichen Ensembles in über 30 Ländern aufgeführt.
Foto: Alexander Schubert
Marc André Weibezahn
AQOO
AQOO ist ein einfacher Raum mit einer Struktur von variierender Komplexität. Orientierung wird zur Herausforderung und zur Chance. Sonische Eindrücke leiten und verwirren, Räume öffnen sich und verschwinden bald wieder. Nichts befindet sich in AQOO.
Es handelt es sich um eine immaterielle und veränderliche Sound-Installation, die dynamisch auf Besucher:innen reagiert. Durch das Minimieren visueller Reize wird die Aufmerksamkeit auf eine Klangumgebung gelenkt, mit der über Bewegung und Positionierung interagiert werden kann. So können zahlreiche, teils überlappende narrative und abstrakte Ebenen freigelegt und individuell interpretiert werden. Sowohl Synthese als auch Darstellung des Klangbildes sind räumlich angelegt.
Marc-André Weibezahn ist Designer, Medienkünstler und Entwickler, dessen Arbeit sich zwischen Code, Klang und Bewegung bewegt. Er entwickelt maßgeschneiderte Software sowohl als Werkzeug als auch als Medium und verbindet dabei Technologie mit künstlerischer Forschung. Seine Werke existieren oft ausschließlich im digitalen Bereich – als lebender Code oder flüchtige Medien –, doch manchmal materialisieren sie sich auch als greifbare Objekte oder räumliche Installationen. In den letzten Jahren hat er sich fast ausschließlich dem experimentellen Klang und der Bewegung zugewandt, was zur Entwicklung mehrerer einzigartiger Anwendungen geführt hat. Seit 2023 ist Marc-André Mitbegründer, Entwickler und Designer von Sonic Moves, einer körperinteraktiven Audio-Software, die Bewegung in Klang umwandelt. Seit 2020 lebt er in Leipzig
Foto: Mahshid Mahboubifar
Oyz
DJ Set (26.11.)
Mit zahlreichen Pseudonymen und Projekten wie einer Radiosendung und dem Free-Party-Kollektiv „selected defected“ verfügt OYZ über ein breites musikalisches Spektrum, das weit über Dance-Musik oder Listening hinausgeht. Als eine Person, die sich auf der Tanzfläche besonders frei fühlt, ist es genau das Gefühl von (musikalischer) Freiheit, das erwartet werden darf.
Oyz arbeitet kollektiv im Hitness Club e.V. und am Neuen Europäischen Bauhaus in Zeitz sowie im mitteldeutschen Strukturwandel – Letzteres gerne auch aus gegebenem Anlass, musikalisch neuinterpretiert.
Foto:
Eine Produktion des ZiMMT e.V. 2025
Kuration: Paul Hauptmeier, Martin Recker, Felix Deufel
Design: Klara Spunk
Website: Nina Buttendorf
Text: Marie Kollek, Tabea Köbler


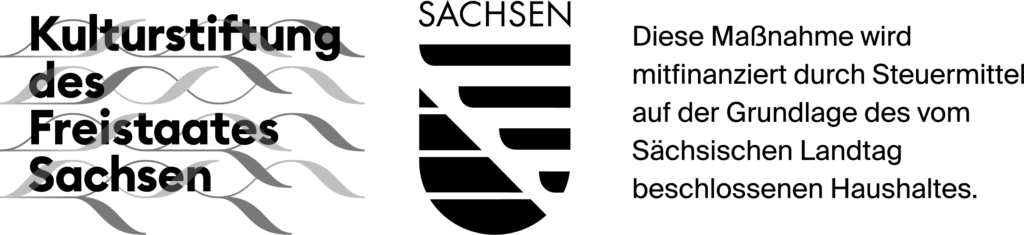

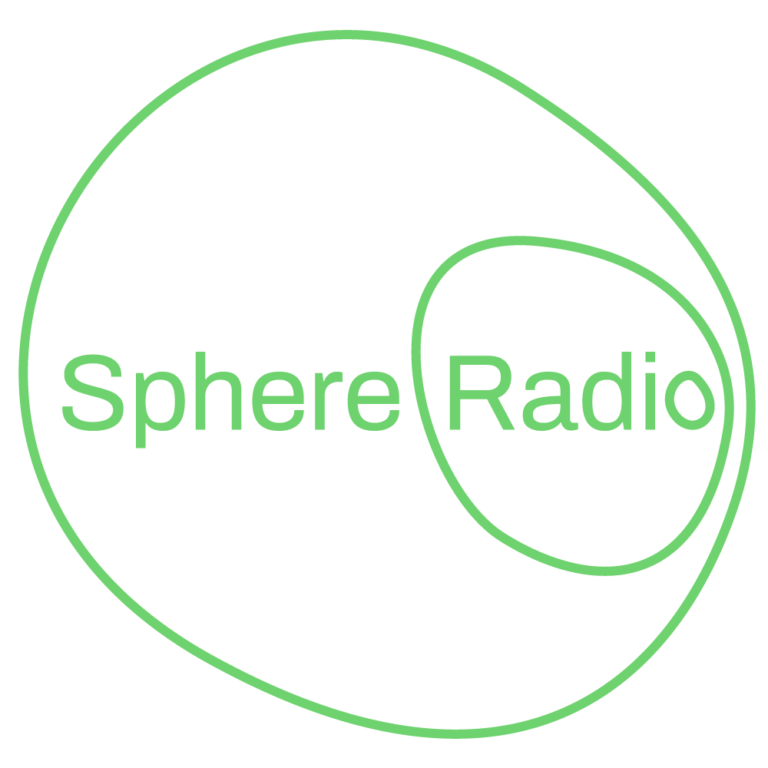
Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or EACEA. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.