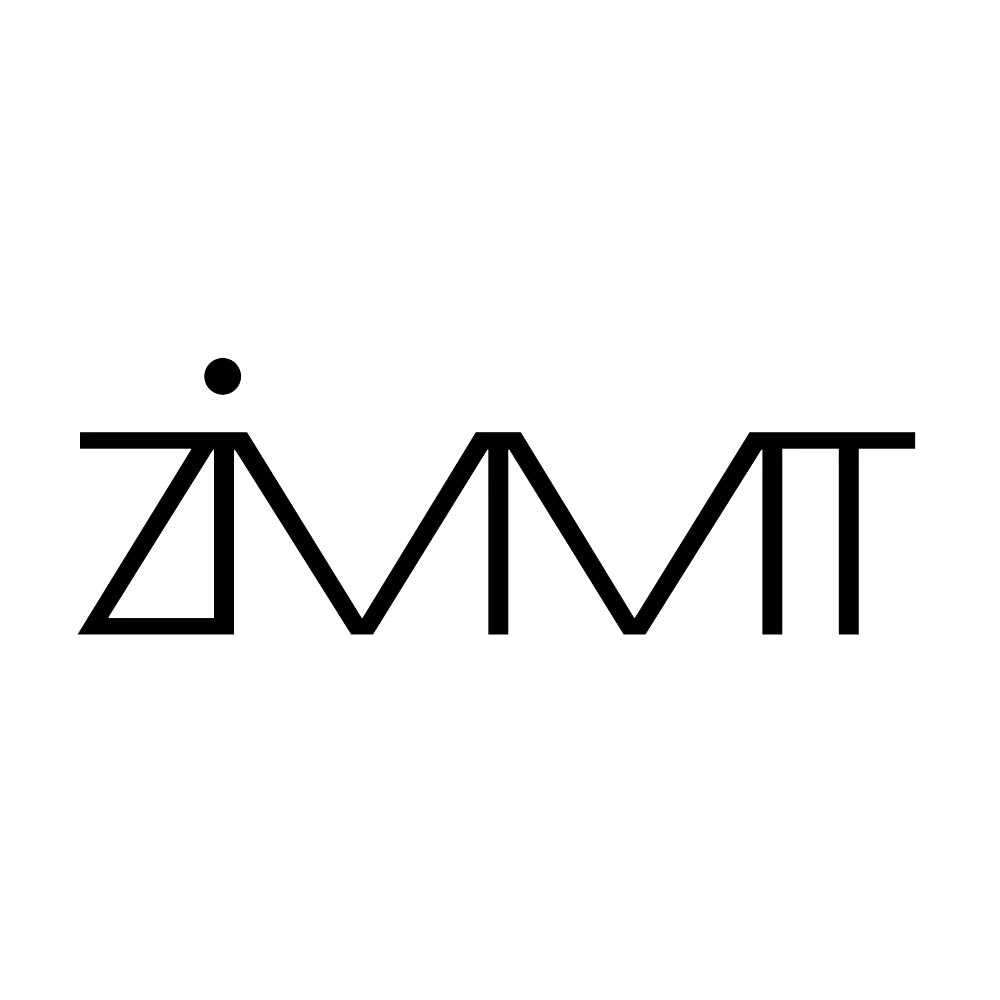Interferenzen
Eine Komposition die aus elektromagnetischen Wellen besteht / 04.–13.11.22
Electromagnetische Drones und noisiges Knistern verflechten sich im Raum, schwirren umher. Sie benötigen kein Medium, um sich auszubreiten, keinen Körper: sie pflanzen sich im Vakuum unabhängig von ihrer Frequenz mit Lichtgeschwindigkeit fort. Schwerelosigkeit. Sie reisen durchs Weltall. Elektromagnetische Wellen sind allgemein als Licht bekannt und folgen den Gesetzen der Optik. Radio- und Fernsehwellen, Mikrowellen, Infrarotstrahlen,
sichtbares Licht, ultraviolettes Licht, Röntgenstrahlen und Gammastrahlen. Wir sind umgeben von einem elektromagnetischen hochfrequenten Wellenmeer, produziert von Internetmasten, Handys, Laptops, Radio, usw. Normalerweise unhörbar, produzieren sie zwischen Systemen manchmal hörbare Interferenzen. Sie können Funkstörungen verursachen, Störfestigkeit und Störaussendungen von Geräten werden gesetzlich reguliert, es gibt eine Verordnung zur Begrenzungen elektromagnetischer Felder und von Funkanlagen. Aus dem Un-hörbaren eingefangen und ins Hörbare übertragen, sonifiziert, wird diese Realität erfahrbar und macht eine unsichtbare Welt um uns greifbarer. Elektromagnetische Wellen sind in der Installation die Klangquellen.
KATHARINA BÉVAND
Katharina Bévand ist eine in Berlin lebende Klangkünstlerin. Sie schafft ortsspezifische Klanginstallationen und Klangskulpturen und performed mit modularen Synthesizern. Sie arbeitet mit bearbeiteten Feldaufnahmen, erweiterten Aufnahmetechniken und der Resonanz von Räumen und Objekten. Kürzlich erhielt sie ein Forschungsstipendium des Berliner Senats. 2017 wurde sie von „bonn hoeren – sonotopia“ der Beethoven-Stiftung für Kunst und Kultur Bonn ausgezeichnet und war von 2018-20 Vorstandsmitglied der Berliner Gesellschaft für Neue Musik e.V.. Ihre arbeiten wurden International ausgestellt u.a. beim FK: K IV Festival in Bamberg, LTK4 in Köln, DARB1718 in Ägypten, Madou Sugar Factory Art Triennale in Taiwan, Dystopia Festival für Klangkunst in Berlin und Space21 Festival in der Autonomen Region Kurdistan im Nordirak. Im Jahr 2018 erhielt sie ein Stipendium des Instituts für Auslandsbeziehungen und des Goethe Instituts Erbil.
Decay 2022—22424
Immersive Soundskulptur 04.–13.11.22
Decay ist der Zerfall des Atoms, die Zersetzung der Metallplatten, das Absterben der Klänge, das Verklingen der Resonanz.
Decay beschäftigt sich mit radioaktiven Zerfallsprozessen und extremen Zeiträumen, welche sich unserer menschlichen Wahrnehmung, Lebensspanne und Vorstellungskraft entziehen. Die hier ausgestellte Klangskulptur ist auf eine Spieldauer von 20.402 Jahren berechnet.
Das “Standortauswahlgesetz” (StandAG) vom 5. Mai 2017 für
den Umgang mit radioaktivem Müll setzt eine sichere Lagerung für eine Million Jahre fest. Decay ist der Versuch, durch die künstlerische Auseinandersetzung zu einem besseres Verständnis für Zeiträume dieser Ausdehnung zu gelangen.
Die Ausbreitungsgeschwindigkeit der Menschen vom afrikanischen Kontinent aus betrug im Schnitt 400 Meter pro Jahr.
Der Homo Erectus, die erste hominine Art, die wie ein moderner Mensch laufen konnte, trat vor ca. 1,8 Millionen Jahren auf.
Der Neandertaler lebte zwischen 230.000 und 30.000 Jahren vor unserer Zeit.
Die älteste Höhlenmalerei der Welt, 2017 in einer Höhle in Sulawesi entdeckt, ist 45.000 Jahre alt und zeigt ein lebensgroßes Warzenschwein.
Das Isotop Neptunium-237, ein Nebenprodukt bei Kernspaltung, hat eine Halbwertszeit von 2,144 Millionen Jahren.
Linguisten schätzen, dass nach spätestens 10.000 Jahren alle heute gesprochenen Sprachen keinerlei erkennbare Verwandtschaft zu ihren Wurzeln mehr aufweisen. #
Antrieb und Impulsgeber von Decay ist ein schwach radioaktives Uranglas. Für jeden mithilfe eine Geigerzählers detektierten radioaktiven Zerfall, löst sich ein Tropfen aus dem elektronisch gesteuerten Ventil im Kopf der Säule, fällt auf die oberste Metallplatte und versetzt diese in Schwingung. Diese Schwingung resoniert in den darunter liegenden Platten, die durch Körperschall-Lautsprecher und Mikrofone in einem komplexen Netzwerk elektroakustischer Rückkopplung miteinander verbunden sind.
Mit fortschreitender Zeit verändert der Tropfen die Resonanzeigenschaften der Metallplatten. Durch die Einwirkung von Sauerstoff und Wasser fängt das Metall an zu rosten und löst sich nach einer berechneten Zeit auf, wodurch der Tropfen auf die drunterliegende Platte trifft, die ab dann tongebend ist. Es ist ein langsamer, doch steter Zerfallsprozess, in Abhängigkeit zu dem zerfallenden radioaktiven Material. Die Klänge zersetzen sich kontinuierlich und sterben langsam ab.
Die angestrebte Lebensdauer einer jeden Platte und die daraus folgende Gesamtaufführungsdauer ergibt sich aus den gewählten Metalllegierungen, der Dicke des Materials, und den äußeren Einflüssen. Mit Unterstützung von Experten*innen des Max-Planck-Institut für Eisenforschung in Düsseldorf, wurde die Plattenzusammenstellung anhand von Korrosionstabellen so präzise wie möglich kalkuliert. Da sich ihr wissenschaftlicher Blick auf dieses Thema selten auf viel längere Zeiträume als 100 Jahre richtet, ist der angegebene Zeitraum eine Hochrechnung. Kleinste Faktoren und Variablen wie Luftfeuchtigkeit, Salzanteil in der Luft, Ph Wert des Wasser und vieles mehr können gravierende Einflüsse auf die Dauern haben. Mögliche Abweichungen der Berechnungen zwischen 10.940 und 114.434 Jahren zeigen das absurde Ausmaß kleinster Variablen in einem so riesigen zeitlichen Rahmen.
Für die Wartung, den Erhalt der Infrastruktur und die Vermittlung des Prinzips der Skulptur gibt es eine Partitur. Sie enthält das Konzept, den generellen Aufbau, die klangliche Entwicklung und den akustischen Jetzt-Zustand der Platten, sowie technische Details, die zum Nachbau und zur Instandhaltung der Skulptur wichtig sind. Um diese, ähnlich der Atomsemiotik, visuell auf eine Art festzuhalten, die auch noch entziffert werden kann, wenn unsere heutigen Sprachen nicht mehr verstanden werden, hat die Künstlerin Elisabeth Liselotte Kraus Übersetzungen gesucht, die mithilfe von Lasergravur in einem Glasquader konserviert sind. Decay ist ein Projekt von IMPULS Sachsen-Anhalt und wird gefördert vom Musikfonds e.V..
Konzept und Umsetzung: Paul Hauptmeier | Martin Recker
Initiiert und kuratiert von Julian Rieken
Schaltkreise: Victor Mazón Gardoqui
Zeichnungen: Elisabeth Liselotte Kraus

All:y:Ears 2022
All:y:Ears ist die zweite Edition der Konzert- und Klanginstallationsreihe Drive In, mit dem Fokus auf 3D Audio Formaten. Bei All:Ears wird der Fokus rein auf das (zu)Hören, die auditive, räumliche Erfahrung gelegt und so der Wahrnehmung von Musik und Klängen eine neue, immersive Dimension verliehen, welche Zuhörende in virtuell-akustische Sphären und Umgebungen eintauchen lässt.
Die Künstler:innen bewegen sich rund um die Genres experimentelle elektronische Musik, Klangkunst, elektroakustische und Soundscape Komposition, multimedia Kunst, neuer Musik und experimentellem Jazz.